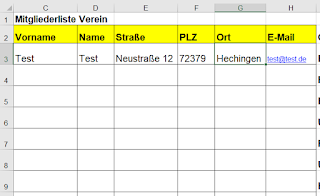Umfrage zeigen, dass viele Verbraucher von dem Recht auf Vergessenwerden Gebrauch machen wollen. Trifft das auch auf Sie zu? Dann sollten Sie zuerst wissen, wie Sie Ihre Daten im Internet überhaupt finden können. Hier sind einige Tipps.
Betroffenenrechte selbst nutzen
82 Prozent der Verbraucher in Europa wollen ihre neuen Rechte aus der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ausüben und die Daten, die Unternehmen zu ihnen erfassen, einsehen, begrenzen oder löschen, so eine Umfrage von Pegasystems. Sogar ganze 90 Prozent wollen sich darüber informieren, wie ihre Daten verwendet werden. Für mehr als die Hälfte (57 Prozent) ist es sehr wichtig, die Nutzung persönlicher Daten direkt zu kontrollieren. Für 31 Prozent ist dies zumindest noch wichtig.
Die deutliche Mehrheit (93 Prozent) würde das Recht zur Datenlöschung nutzen, wenn Unternehmen ihre Daten auf eine Weise nutzen, mit der sie nicht einverstanden sind. 89 Prozent würden das Geschäftsverhältnis daraufhin ganz kappen. Über Dreiviertel der Befragten (78 Prozent) bevorzugen Unternehmen, die mit den Daten offen und transparent umgehen. Knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) würde ihre Daten gelöscht haben wollen, wenn Unternehmen die Informationen mit anderen Unternehmen austauschen oder gar verkaufen würden.
 |
| Das Recht auf Vergessenwerden - Wie Sie Ihren Löschanspruch umsetzen |
Es stellt sich die Frage: Wie ist es mit Ihnen? Wollen auch Sie zum Beispiel das Recht auf Vergessenwerden nutzen? Doch wie geht das eigentlich?